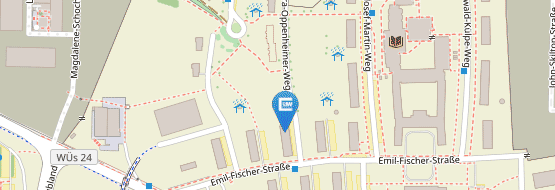Abhängigkeit von Ameisen ist bisher kein Risikofaktor für mitteleuropäische Bläulinge
Angesichts des steigenden Einflusses menschlicher Aktivitäten sind generalistische Arten, also solche mit breiterem Nahrungsspektrum und Lebensweise, meist robuster als spezialisierte Arten. Ein Beispiel für eine solche Spezialisierung zeigen manche Schmetterlinge aus der Familie der Bläulinge (Lycaenidae), deren Raupen die Fürsorge bestimmter Ameisenarten in Form von Schutz und Nahrungsversorgung zum Überleben brauchen. Diese Form der Abhängigkeit von Ameisen nennt sich Myrmekophilie und kann in verschieden starker Ausprägung auftreten. Insbesondere für stark auf Ameisen angewiesene Schmetterlingsarten könnte diese Abhängigkeit unter den verschiedenen Aspekten des globalen Wandels eine zusätzliche Bedrohung darstellen.
Überraschenderweise haben Forscherinnen und Forscher der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) in Bayern, Deutschland, nun allerdings entdeckt, dass auf Ameisen angewiesene Bläulingsarten in den letzten 40 Jahren keinen stärkeren Rückgang zeigten als Ameisen-unabhängige Bläulinge. Tatsächlich nahmen fünf von sieben dieser „obligat myrmekophilen“ Arten sogar zu, während fünf von acht der ameisenunabhängigen Arten zurückgingen. Die Bläulinge mit nur gelegentlicher Ameisenabhängigkeit wiesen uneinheitliche Trends auf, die Unterschiede waren jedoch statistisch nicht signifikant. Die Ergebnisse der Studie wurden nun in der Zeitschrift Insect Conservation and Diversity veröffentlicht.
Obwohl streng myrmekophile Bläulinge häufiger unter strengen Schutzmaßnahmen stehen, schien dies keinen Einfluss auf ihre langfristige Entwicklung zu haben. Ein Grund für die relative Stabilität dieser Arten könnte ihre Fähigkeit sein, mit verschiedenen Ameisenarten zusammenzuarbeiten – vor allem mit weit verbreiteten Gattungen wie Myrmica, Formica und Lasius. Die Ameisen schützen die Raupen vor äußeren Einflüssen, was die Auswirkungen veränderter Bedingungen vorerst abmildern könnte.
Unser Wissen über die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Schmetterlingen und Ameisen und den unterschiedlichen Grad der Abhängigkeit ist jedoch noch unvollständig. Gerade dieses Wissen könnte dabei helfen, gezielte Schutzmaßnahmen für gefährdete Arten zu entwickeln. Die Studie ist zum einen ein Beispiel dafür, wie Erfahrungen aus der Feldarbeit und Computermodellierungen zusammengebracht werden können, um die Erkenntnisse der Einzeldisziplinen aufzuwerten und zu neuen Erkenntnissen zu führen. Zum anderen zeigt sie, dass auch nicht signifikante Ergebnisse wertvolle Einsichten bringen, die es wert sind, veröffentlicht zu werden. Sowohl weitere Feldarbeit als auch auf deren Erkenntnissen beruhende Modellierungen sind notwendig, um Arten in Zukunft zu schützen. Angesichts der sich schnell wandelnden Umwelt ist es wichtig, Interaktionen fortlaufend zu beobachten, um Risikofaktoren und stabilisierende Einflüsse besser zu verstehen und ein gekoppeltes Aussterben von Arten zu verhindern.
Originalpublikation
Eva Katharina Engelhardt, Diana E. Bowler, Matthias Dolek, Melvin Kenneth Opolka, Christian Hof: Myrmecophily is not a risk factor for long‐term occupancy trends of central European Lycaenidae butterflies. In: Insect Conservation and Diversity, 16.10.2024. DOI: https://doi.org/10.1111/icad.12782
Kontakt Dr. Eva Katharina Engelhardt, Lehrstuhl für Globale Ökologie, E-Mail: eva-katharina.engelhardt@uni-wuerzburg.de